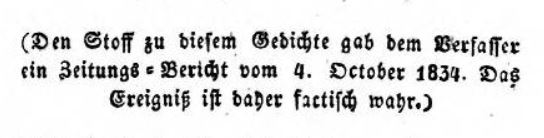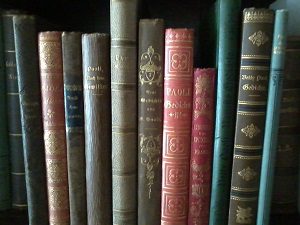Betty Paoli rezensiert Gedichte – oder auch nicht
„Zehn Bände Gedichte liegen vor uns. Zehn Bände! Du brauchst aber deshalb nicht zu erschrecken, lieber Leser; es fällt uns nicht im Traume ein, dir über diese ganze Bibliothek zu referiren. Von den erwähnten zehn Bänden stehen sieben so tief unter der Mittelmäßigkeit, daß die Kritik nicht mehr mit ihnen zu schaffen hat, wie mit dem Gequake der Frösche, deren lyrischer Drang sich an schönen Sommerabenden Luft macht. Weil wir aber nicht fordern können, daß du uns dies auf’s Wort glaubest, wollen wir unsere Behauptung mit einigen Citaten unterstützen. Hast du an diesen nicht genug und forderst dann noch eine gründliche Analyse des Ganzen, so soll dir werden, was du verdienst. Thörichtes Verlangen wird am härtesten dadurch bestraft, daß man es gewährt. Vorläufig erfreu dich an den folgenden Citaten.
Herr Carl Ludwig Blum singt (Seite 46) in dem „Lied einer Wahnsinnigen“:
„Holofernes und David und Salomon,
Diese drei Weisen, die wußten es schon!
Adam und Eva hat’s Lieben erdacht,
Ich mit mein’m (!!!) Schätzel hab’s auch so gemacht.“
In einem andern „mit einer Mundtasse“ betitelten Gedicht heißt es:
„Sieh Mamachen diese Tasse
Und darin ist auch Kaffee!
Du verstehst dich auf dies Nasse
Mehr als ich auf’s ABC.“
Ehrlich gestanden ist uns Herr Blum unter dem poetischen Siebengestirn noch beiweitem der Liebste. Seine Verse sind nicht mittelmäßig, sie sind positiv schlecht; die Gedanken, die er vorbringt, sind nicht abgeblaßte Reflexe fremder Ideen, nein! sie glänzen durch selbstständige Absurdität, mit einem Wort, sein Buch hat einen ausgesprochenen Charakter, und es ließe sich daraus eine Blumenlese zusammenstellen, die im Verein mit kalten Waschungen, Bewegung im Freien und dem Gebrauch des Kissingerbrunnens zur Heilung manchen Hypochonders beitragen dürfte. Die andern sechs Bände sind nur langweilig…“
Betty Paoli: Bücherschau. In: Wiener Lloyd 15. Juni 1854 , S. 1-3.