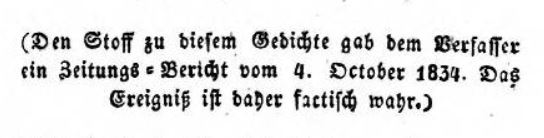Mit sechzehn Jahren musste Betty Glück, später bekannt unter dem Namen Betty Paoli, mit ihrer Mutter von Wien nach Russland übersiedeln, um dort als Gouvernante Geld zu verdienen. Aber die beiden waren nicht glücklich im fremden Land, und so zogen sie nach Österreich zurück (bei Nacht und Nebel weil illegal, so erzählte es Marie von Ebner-Eschenbach) und zwar nach Galizien, konkret in den Teil, der heute zu Polen gehört. Dort lernte Betty Glück einen interessanten Herren namens Carl Lewinski kennen, der später Karriere bei der österreichischen Polizei machen sollte, zu der Zeit aber noch k.k. Landrechtsauscultant in Lemberg war. Dass Lewinski nicht nur ein besonderer Freund sondern auch ein kritischer Heine- und Lenauleser und als solcher eine wichtige literarische Auskunftsperson für Paoli war, habe ich beim wissenschaftlichen Kolloquium der 6. Österreich-Tage in Drohobytsch, der Stadt von Bruno Schulz, erzählt.
Von drei Tagen Konferenz kann ich berichten, aber wie immer, wenn es in meinem Blog um Zusammenkünfte wissenschaftlicher Art geht: Ich widme mich dem Rahmenprogramm. Das hat es wirklich in sich gehabt. Drohobytsch hat nicht nur eine Uni mit einem großen Festsaal, sondern auch ein imposantes Kulturhaus, eine Stadtbibliothek, ein Kunstpalais und eine sehr hübsche Österreich-Bibliothek, deren Leiter Jaroslaw Lopuschanskyj für die Organisation der Österreich-Tage zuständig ist. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, er ist ein großer Organisator.
Fotoausstellungen, Lesungen, eine literarisch kommentierte Ausstellung zu Georg Trakl, Konzerte, Buchpräsentationen… kaum zu glauben, was man an drei Konferenztagen neben den Vorträgen noch alles unterbringen kann. Und dabei habe ich die Besichtigung der St. Georgskirche, einer Holzkirche aus dem späten 15. Jahrhundert, noch gar nicht erwähnt, und den Spaziergang über das Gelände der stillgelegten Saline.
Salz war wirtschaftlich und ist in der Küche wichtig, Essen und Trinken ist völkerverbindend, daher noch etwas zum kulinarischen Rahmenprogramm, zu dem auch ein besonderes salzburgisches Abendessen von Roland Essl und großzügig gespendeter Wodka gehört hat. In der Ukraine gibt es guten Kaffee (Kolschitzky, der nach einer Legende, die vielleicht nicht wahr ist, das erste Wiener Kaffeehaus gegründet hat, wurde in der Nähe von Lemberg geboren) und: Das Land ist reich an Pilzen.