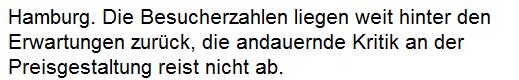„Usability-Guru“ Jakob Nielsen lässt uns wissen, dass gut geschriebener Text die einzige Möglichkeit ist, UserInnen dazu zu bringen, Websites zu lesen. „Information architecture“ und Layout der Seite seien auch wichtig, aber qualitativ hochwertiger Text sei das Wichtigste, womit man Userinnen und User dazu bringen kann, mehr als die durchschnittlichen 28 Prozent des Texts einer Website zu lesen.
Nun, das mag sein. Und ich bin natürlich auch dafür, dass Websites gut getextet werden. Aber: In jüngster Zeit habe ich mich verstärkt mit dem Phänomen des „social reading“ befasst. Das bezeichnet den Umstand, dass die einsame Tätigkeit des Lesens (von Literatur) sehr, sehr vielen technikaffinen Menschen zu einsam ist. Sie wollen ihren Facebook-Friends erzählen, dass sie ein Buch lesen, wo und warum sie es lesen und vielleicht auch, ob es ihnen gefällt oder nicht. Kobo und Goodreads z.B. machen vor, wie alle Möglichkeiten der virtuellen Gemeinschaftsbildung mit der Tätigkeit des Freizeitlesens von fiktionaler Literatur verknüpft werden können.
Wie aber teilt sich die soziale Leserin, der soziale Leser mit? Schriftlich. In diesen Texten wird zum Beispiel ausgedrückt, dass die Tante K. der Leserin das Buch zum Geburtstag geschenkt hat und dass das Buch dann drei Wochen auf einem Stapel neben dem Bett gelegen ist, und endlich, an einem sehr regnerischen Tag, hat die soziale Leserin dann zu diesem Buch gegriffen, hat es zuerst blöd gefunden, aber es ist dann gleich spannend geworden, und deswegen wird sie, die soziale Leserin, sich jetzt den zweiten Band der Trilogie selber kaufen. Das ist ein fiktives, paraphrasiertes Beispiel für eine Mitteilung, wie man sie auf jeder beliebigen Plattform für soziales Lesen finden kann. Interessanter als der Inhalt ist bei dieser Gemeinschaftsbildung über Bücher aus meiner Sicht aber das Wie.
Mindestens die Hälfte der gemeinschaftsbildenden Texte über Bücher, die ich bei meiner Recherche gelesen habe, sind schlecht geschrieben, nämlich grammatikalisch wie orthographisch unoriginell falsch. Und auch ihr Aufbau folgt in keiner Weise dem, was Jakob Nielsen für guten Webtext empfiehlt. Das Wichtigste steht nicht an erster Stelle, der erste Satz ist nicht voller Information und lässt keinesfalls vermuten, dass im Fortgang der Lektüre irgend eine Aussage von Relevanz zum Buch oder zur Person der Schreiberin zu erwarten wäre.
Was ich damit sagen will: Jakob Nielsen mag damit Recht haben, dass guter Webtext für Seiten, die etwas verkaufen wollen, wichtig ist. Gleichzeitig beobachte ich aber eine sehr hoheToleranz gegenüber schlechten Texten in einer Gruppe, in der ich sie nicht vermutet hätte: bei Leserinnen und Lesern von (Unterhaltungs)Literatur.
Bei sozialem Lesen (und Laienkritik) geht es nicht um Bücher, sondern um Aufmerksamkeit für die Person, die möglicherweise ein Buch gelesen haben könnte. Die lässt sich auch mit schlechten Texten erreichen.